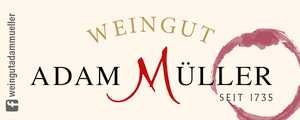NABU warnt vor Rückinfektionen und neuen Mutationen der Geflügelpest
Sorge um Auswirkungen auf Wildvögel
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) blickt mit Besorgnis auf die zunehmenden Ausbrüche der Geflügelpest in Nutztierhaltungen. Nach Einschätzung von NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger steht für den Verband vor allem die mögliche Rückwirkung auf wildlebende Vogelarten im Vordergrund. Krüger warnt davor, die Infektionswege als Einbahnstraße zu betrachten: Wo sich Viren in Geflügelhaltungen vermehren, könnten sie auch wieder in andere Bestände oder in die Natur gelangen.
Unklare Infektionswege und globale Verbreitung
Auch das Friedrich-Loeffler-Institut schließt Übertragungen aus Geflügelhaltungen nicht aus. Die genauen Infektionswege gelten als schwer nachvollziehbar. Niedrigpathogene Geflügelpestviren sind seit Langem in Wildvogelpopulationen bekannt, die hochansteckende Variante H5N1 entstand jedoch in ostasiatischen Geflügelbetrieben. Von dort aus verbreitete sie sich über Wildvögel und Handelsrouten weltweit. Heute ist das Virus ganzjährig aktiv und auf allen Kontinenten außer Australien verbreitet. Wie das Virus beim aktuellen Ausbruch Kraniche infizieren konnte, bleibt unklar. Bereits im Frühjahr und Sommer gab es in Europa einzelne Fälle bei Wildvögeln und in Geflügelhaltungen.
Forderung nach mehr Forschung
Krüger betont die Notwendigkeit verstärkter Forschung, um die Verbreitungsmechanismen des Virus besser zu verstehen. Nur so lasse sich die Geflügelpest wirksam eindämmen. Die anhaltenden Mutationen stellten Wissenschaft und Naturschutz zunehmend vor Herausforderungen. Immer mehr Vogelarten seien betroffen, und bei Säugetieren wie Nerzen und Robben komme es inzwischen zu Masseninfektionen innerhalb der Arten.
Bedrohung für Kraniche und andere seltene Vogelarten
Für seltene Arten wie den Kranich kann die Geflügelpest schwerwiegende Folgen haben. Die bisherigen Schutzbemühungen der letzten Jahrzehnte könnten dadurch gefährdet werden. Der NABU schätzt, dass rund 400.000 europäische Kraniche in Deutschland rasten oder durchziehen, während etwa 12.500 Paare hierzulande brüten. Da Kraniche nur ein bis zwei Jungtiere pro Jahr aufziehen, reagieren ihre Bestände empfindlich auf Einbrüche. Zusätzlich erschwert der Klimawandel mit dem Rückgang von Feuchtgebieten den Bruterfolg.
Lebensräume sollen verbessert werden
Um die Kranichpopulation und andere Wildvogelarten zu schützen, fordert der NABU eine gezielte Verbesserung ihrer Lebensräume. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür seien mit dem EU-Renaturierungsgesetz („Restoration Law“) geschaffen. Nun liege es an den Bundesländern, konkrete Maßnahmen zur Umsetzung zu entwickeln.
Quelle: NABU
Kurz-URL: https://nussloch-lokal.de/?p=189994